
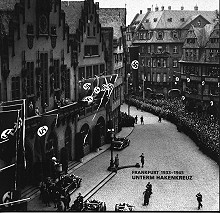
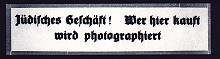

Wo
man Bücher verbrennt,
verbrennt man am Ende Menschen.
(Heinrich
Heine)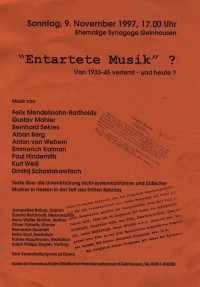
Das
Programm von 1997:
"Entartete Musik" ?
Von 1933-45 verfemt
-
und heute?
Texte über die Unterdrückung
nicht-systemkonformer
und
jüdischer Musiker in Hessen in
der Zeit des Dritten Reiches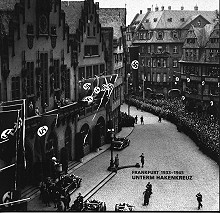
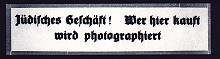

Wo
man Bücher verbrennt,
verbrennt man am Ende Menschen.
(Heinrich
Heine)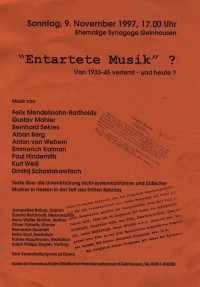
Das
Programm von 1997:
"Entartete Musik" ?
Von 1933-45 verfemt
-
und heute?
Texte über die Unterdrückung
nicht-systemkonformer
und
jüdischer Musiker in Hessen in
der Zeit des Dritten Reiches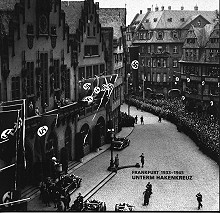
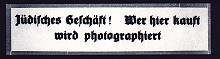

Wo
man Bücher verbrennt,
verbrennt man am Ende Menschen.
(Heinrich
Heine)
- Kultur im Nationalsozialismus"
KonzertCollage
Schönberg, Celan, Weill,
Goebbels, Mahler...
Gelnhauser Tageblatt vom 13.11.1997
Erinnerung an
einst geächtete Werke
Konzert in der
ehemaligen Synagoge rief während NS-Zeit verbotene Musik ins Gedächtnis
zurück - "ProOpera" brillierte
GELNHAUSEN (gt).
Um ab dem Jahr eins seines "tausendjährigen Reiches" das Braun
der Dreißiger im Knobelbecher-Marschschritt festzustampfen, mußte
man zuerst mit scharfen Mitteln das Gold der Zwanziger, als dem freiheitlichen
Deutschlands in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, abschmirgeln: Ob per
antisemitischer Hetze oder nach selbstgeprägter Skala einfach als "undeutsch"
oder "nicht völkisch" abservieren.
Wie fließend die Übergänge,
wie ambivalent die Positionen, wie unfaßbar die Gesamtheit von Weltgeschehen
wie Realität speziell der Musikwelt von 1933-45 waren, zeigte die Gelnhauser
Operncompagnie "ProOpera" in der Ehemaligen Synagoge zum Jahrestag der
"Reichskristallnacht" in einem eindringlichen, mit die Zeit vor sechs
Jahrzehnten vergegenwärtigenden Lesungen durchsetzten Gedächtniskonzert
auf.
Das Gedenken an die im Dritten Reich unterdrückten Musiker kann nicht
immer nur in Tönen der Depressivität zurückgerufen werden. Wenn
die Sängerin Jacqueline Balazs mit Emmerich Kalmans "Höre ich Zigeunergeigen"
quirlig und rasant durch den Raum wirbelt, mit frischer Mimik und gänzlich
unaffektierter, quicklebendiger Fröhlichkeit die erfrischenden Melodien in
klaren Klang und belebte Szene umsetzt, dann wird im lebendigen Beispiel vor Augen
gefürt, welche lebensnahe, entspannende und einfach nur "schöne"
Kunst da plötzlich unter ein unmenschliches Veto fiel. Und während Kalman
ja immerhin den Krieg überstand, starb sein Kollege Leon Jessl ("Schwarzwaldmädel")
hinter nationalsozialistischen Gefängnismauern.
Anton von Weberns Musik
ist da noch ein anderes Kaliber, die allerdings viel von ihrer per Interpreten
oft aufgedrückten Sperrigkeit verliert, wenn sie so impulsiv und plastisch
vorgetragen wird wie in der spannenden, von musikalisch-intellektueller Einsicht
in die Prinzipien der Partitur geprägten Darstellung der Variationen op.
27 durch den Pianisten Oliver Fürbeth. Felix
Mendelssohn Bartholdy war unter den Verbotenen der erste nach dem Krieg
wieder voll Eingegliederte, und Hans-Walter Richter gab sanft und schön melodisch
einen Viererblock überwiegend bekannterer Mendelssohn-Klavierlieder. Das
Werk von Bernhard Sekles (1873-1934), dem zur Einleitung des Abends der Musikwissenschaftler
Ralph Philipp Ziegler die menschlich-historische Hommage "Gedanken an Bernhard
Sekles. Einen ihrer" widmete, hat sich nie vom Veto im Dritten Reich erholt.
Markus Mathiesl gab zwei atmosphärenreiche Klavierlieder nach Rücken-Texten,
von denen speziell das fast impressionistische "In Meeresmitten" durch
den klangvollen, sicher geführten Bariton ein- und ausdrucksvoll zur Geltung
kam. Paul Hindemith schließlich hat sich nur durch seinen musikalischen
Freigeist unbeliebt gemacht, und gerade die "English Songs", von denen
Sandra Reichard drei mit Klang und Charme vortrug, machen deutlich, wie sehr der
gebürtige Hanauer (und Sekles-Schüler) auch noch im leicht zeitgenössisch
gelösten Romantischen neue Ausdrücke finden konnte.
Zum Finale spielte
das "Bemardel-Quartett" den ersten Satz aus Shostakovichs "Siebtem"
- transparent, charakteristisch und voller Energie eine prägnante und eindrückliche
Darstellung durch die jungen Musikerinnen. Jacqueline Balazs beinahe pur lebhafter
Mahler, ihr hochemotionaler Weill ("Surabaya-Johnny") oder der erste
Satz aus Mendelssohns Quartett op. 44 Nr. 2 rundeten ein qualitätvolles Musikprogramm
mit feinsinnigen Ereignissen ab. Damit nichts "einfach nur schön"
blieb, konfrontierte Rainer Hauptmann die Musik auf Schritt und Tritt mit authentischen
Zitaten aus der politischen Geschichte Gelnhausens und der Musikgeschichte allgemein.
Petra Graf kommentierte in der reflektierenden Zeilen per Gedichten von Heym,
Celan und Heine, beide mit Persönlichkeit und Sinn für die historische
Qualität der Textaussagen. Es wurde zum schönen und schlimmen, zum lustigen
und schrecklichen Abend, vor allem aber zu einer herzlichen Erinnerung.
Wiesbadener Tagblatt vom 14.08.1999
Kreative Ideen
mit einer inhaltlichen Substanz
Kooperative "Die
Cavallerotti" will in Wiesbaden ein kulturelles Netzwerk zur Förderung
des Nachwuchses aufbauen
dh. Die Idee zur Wiesbadener Kulturkooperative
"Die Cavallerotti" wurde im Oktober 1996 geboren. Seither bemüht
sich der Zusammenschluss von Künstlern, Musikern, Filmschaffenden und Dozenten
darum, ein kulturelles Netzwerk zu knüpfen, das Projekte und Initiativen
mit Nachwuchstalenten unterschiedlicher Ausprägung ermöglicht. Angesprochen
sind Künstler mit hoher Qualifikation, die jedoch aufgrund des "überfüllten
Marktes" im konventionellen Rahmen bisher kaum Betätigungsfelder finden
konnten. Gemeinsam soll innerhalb der Kooperative nach Formen gesucht werden,
um eigenständige Projekte zu realisieren und somit den künstlerischen
Dialog weiterzuentwickeln. Durch den Kooperativansatz könne auch mit wenig
Geld aber viel Engagement erhebliches geleistet werden, so ist sich Rainer Hauptmann,
Initiator und Leiter der "Cavallerotti" sicher.
Die bisher geleistete
Arbeit gibt ihm dabei recht. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für
Filmkunde wurde im September 1997 der Paul-Leni-Film "Dornröschen"
aus dem Jahre 1917, musikalisch begleitet von einer Komposition für Salonorchester
des polnischen Komponisten Jerzy Skorsky, aufgeführt. Unter Leitung der Frankfurter
Dirigentin Natalie
Schwarzer spielten damals Mitglieder des Landesjugendorchesters Hessen.
Mit diesem Programm gastierten die Musiker mittlerweile auch in Hamburg, weitere
Gastspiele in Deutschland sind in Planung.
"Diese Musik wurde ermordet",
hieß eine Kombination aus Lesung und Musikvortrag "mit der vor allem
die antisemitischen Anfeindungen, denen sich der jüdisch-stämmige Komponist
Felix
Mendelssohn Bartholdy ausgesetzt sah, näher beleuchtet wurden. Die
Korrespondenz zwischen Vortrag und Musik, die Auseinandersetzung und nicht bloße
Interpretation von Musik war ausschlaggebend bei den Veranstaltungen. Gerade ist
die Produktion einer Dokumentations-CD abgeschlossen, die den Vortrag und den
kompletten Liederzyklus op. 65 sowie das ursprüngliche Konzertprogramm beinhaltet.
Die Doppel-CD soll nahezu zum Selbstkostenpreis vor allem an Bildungseinrichtungen
abgegeben werden, um eine intensivere Beschäftigung mit dem Themenkomplex
zu ermöglichen.
Rainer Hauptmanns Konzept bei allen Aktivitäten folgt
einer eigentlich schlichten Formel: "Wir wollen Themen aufgreifen, die uns
faszinieren." Heraus kommt wohl keine populäre Unterhaltung, denn "das
können andere besser". Wohl aber entstehen im Verbund mit der Kulturkooperative
kreative Ideen mit inhaltlicher Substanz. Die künstlerische Eigenständigkeit
bleibt stets gewahrt, da die bewussten Alternativ-Modelle weniger dem ökonomischen
Zwang als der konsequenten Realisierung der gesetzten kulturellen Ziele folgen.
Dabei müssen die "Cavallerotti" auch nicht unbedingt im Vordergrund
stehen. Oftmals reicht es, Kontakte herzustellen oder Denkanstöße zu
geben.
So entwickelt sich zur Zeit ein immer weiter gespanntes Netz von Personen,
Ideen und Projektvorstellungen. Hauptmann selbst zieht seine Motivation, oft auch
langwierige Verhandlungen und organisatorische Vorhaben durchzustehen, aus einer
ehrlichen Begeisterung. Lange Zeit arbeitete er in unterschiedlichen Funktionen
auf und an der Bühne, bis er schließlich in einer freien Filmproduktion
während eines Orchesterworkshops auf die Idee der Kooperative kam. Mittlerweile
haben ihm seine Aktivitäten die Gelegenheit geschaffen, an einem Kulturmanagementstudium
in München teilzunehmen, aber auch dort werden weiterhin die Fäden gesponnen.
Übrigens:
"Cavallerotti" ist die Bezeichnung der als unzuverlässig, wankelmütig
und kleinbürgerlich geltenden Parteigänger und Schwertleute im Italien
des Trecento. Es handelte sich dabei um die unterste Oberschicht, die bei politischen
Entscheidungen zumeist durch ihre Korrumpierbarkeit und Tücke auffiel und
ihr Mäntelchen in den jeweils wehenden Wind hing. Eine Anspielung, die bewusst
mit einem augenzwinkernden Seitenhieb auf das Gerangel in der freien Kulturszene
gewählt wurde, verrät Hauptmann.